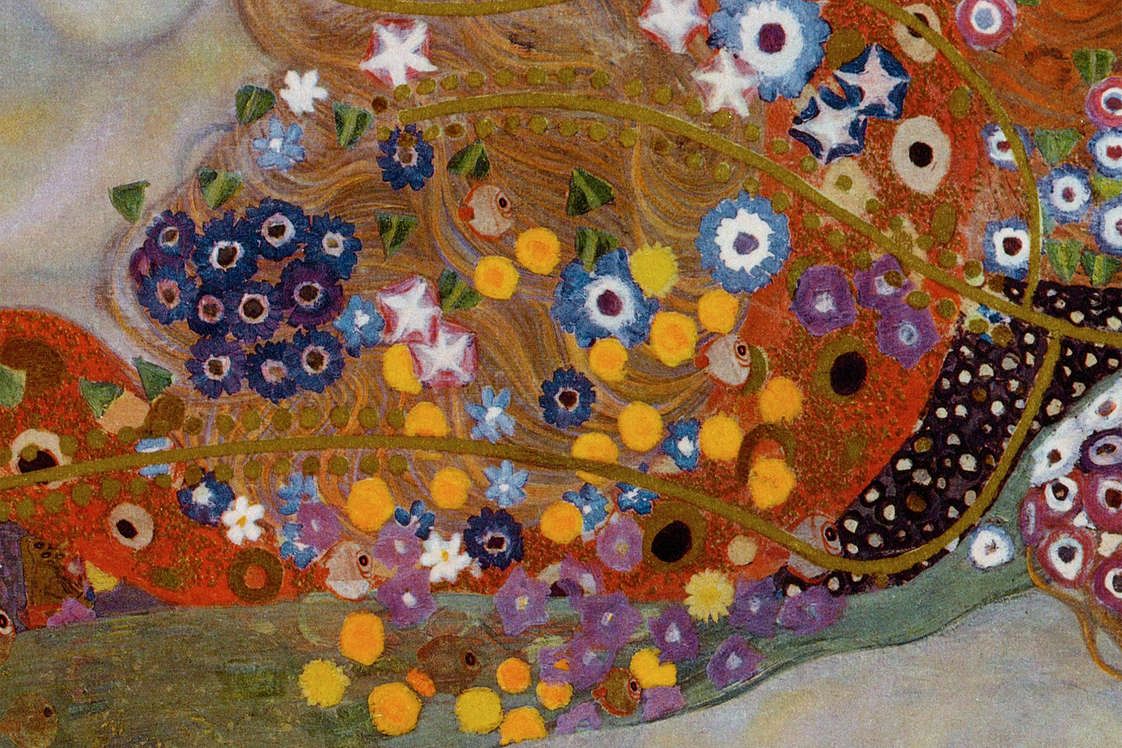DFB-POKAL
Dortmund gastiert zum Schlager in Leipzig
Die Abfuhr gegen Bayern München in der Liga hat Borussia Dortmund schnell verdaut, die Saisonziele haben sich durch die 2:4-Abfuhr kaum geändert. „Wir wissen, dass es noch ein paar Wochen gibt, in denen wir ein paar Dinge gutmachen können“, betonte Trainer Edin Terzic vor dem Gastspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig. Allerdings möchte auch der Titelverteidiger aus Sachsen im Cup Selbstvertrauen für den Saisonendspurt tanken.Online seit heute, 12.33 UhrTeilen
„Wir haben immer gesagt, dass Borussia Dortmund um Titel spielen will. Und der DFB-Pokal bietet den kürzesten Weg“, sagte Terzic. „Es ist für uns diese Saison nicht einfach, weil wir bisher komplett auswärts spielen mussten. Aber wenn wir den Titel holen wollen, müssen wir auch schwere Aufgaben lösen“, sagte er vor der Reise nach Leipzig. Terzic gewann als Interimscoach 2021 mit Dortmund den Pokal durch ein 4:1 gegen Leipzig mit Trainer Julian Nagelsmann, wurde dann aber von Marco Rose abgelöst, den er wiederum nach einer Spielzeit beerbte und der heute RB-Trainer ist.


„Vor zwei Jahren den Pokal zu gewinnen, war unbeschreiblich, aber nicht vollständig. Weil unsere Fans nicht dabei waren“, sagte Terzic mit Blick auf das pandemiebedingt ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgetragene Endspiel: „Das wollen wir dieses Jahr vervollständigen.“ Trotz der teilweise frustrierenden Leistung in München sieht Terzic auch „absolut keinen Grund, negativ oder pessimistisch in die nächsten Aufgaben zu gehen. Wir sind weiter eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga und vielleicht in Europa.“Datenschutz-Einstellungen öffnen:Soziale Netzwerke vollständig anzeigen
Bis zum @dfb_pokal-Endspiel in Berlin sind es nur noch zwei Siege!
Und Siege gegen den @bvb, besonders zu hause, KÖNNEN WIR!#RBLBVB pic.twitter.com/LEaDcqnu2e— RB Leipzig (@RBLeipzig) 3. April 2023
Rose nimmt Leipziger „in die Pflicht“
Im Gegensatz zu den Leipzigern, die zuletzt drei Spiele hintereinander verloren haben. Der Krise sind sich Trainer und Spieler, die sich zu Wochenbeginn ohne ihren Coach ausgesprochen haben, durchaus bewusst. „Wir haben zu wenige Erfolgserlebnisse, entsprechend sind Stimmung und Atmosphäre“, sagte Rose. Die Lösung sei nun, die Dinge klar anzusprechen. „Die Mannschaft ist kein aufgeschreckter Haufen, der nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Sie ist nicht in eine Depression verfallen“, betonte Rose.DFB-POKALSpielplan und Ergebnisse
Auf Erinnerungen an den Pokalsieg im vergangenen Mai will Rose zur Motivation verzichten. Das passe nicht zur Lage. „Ich muss die Mannschaft in die Pflicht nehmen“, sagte der 46-Jährige. „Nur schöne Bilder zeigen und daran erinnern zu lassen, wie cool alles war, das hilft uns nicht weiter“, sagte der ehemalige Salzburg-Trainer. Von der aktuellen Misere der Leipziger will sich Terzic nicht blenden lassen. „Für sie ist es wohl die einzige Chance, diese Saison einen Titel zu holen. Deshalb werden sie als Titelverteidiger alles tun, um ins Finale zu kommen“, sagte er. „Aber wir wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen.“
Stuttgart hofft auf Trainereffekt
Im zweiten Mittwoch-Spiel (18.00 Uhr) gibt Sebastian Hoeneß sein Debüt als Trainer des VfB Stuttgart. Der Tabellenletzte hat am Montag Bruno Labbadia entlassen, das Pokalspiel bei Zweitligist 1. FC Nürnberg ist für den 40-Jährigen der Start in eine schwierige Aufgabe. Hoeneß ist nach Pellegrino Matarazzo, dem Intermezzo des aktuellen Austria-Wien-Trainers Michael Wimmer als Interimslösung sowie Labbadia schon der vierte Coach der Schwaben seit Saisonbeginn.
„Es gibt natürlich einen Plan. Es ist aber extrem wichtig, dass wir mit einem gewissen Schuss Pragmatismus an die Sache rangehen“, sagte Hoeneß, der an die Qualität des Teams glaubt. „Dieses Spiel ist eine Riesenchance für uns als Club. Wir wollen dort einen nächsten Step in Richtung Berlin machen.“ In der Hauptstadt findet am 3. Juni das Endspiel statt. Ein weiteres – und wichtigeres – Ziel ist das Erreichen des Klassenverbleibs. Zwei Punkte beträgt der Rückstand des VfB auf den Relegationsplatz 16, jedoch schon fünf auf den rettenden 15. Rang.
Ein Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal wäre für die Stuttgarter demnach kein Beinbruch. Dennoch gibt es für Nürnberg-Trainer Dieter Hecking keine Zweifel an der Rollenverteilung. „Ich glaube, dass der VfB Stuttgart morgen sehr, sehr viel zu verlieren hat. Wir können sehr viel gewinnen“, meinte der 58-Jährige. „Die Situation könnte uns bei entsprechendem Spielverlauf in die Karten spielen. Wenn wir es schaffen, Stuttgart auf ein gewisses Niveau runterzuziehen, dann sind wir nicht chancenlos.“
red, ORF.at/Agenturen
Link:
QELLE : ORF.AT